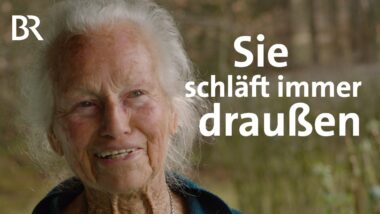Leben mit und ohne Plastik


Über ihre Erfahrungen und die Umstellung der Lebensgewohnheiten berichtet Familienmutter Sandra Krautwaschl im aktuell erschienen Buch Plastikfreie Zone: Wie meine Familie es schafft, fast ohne Kunststoff zu leben „Eigentlich hätte es ursprünglich nur ein Experiment sein sollen, um zu sehen, ob das überhaupt möglich ist“, erklärt Krautwaschl, die mit ihrem Ehemann und drei Kindern außerhalb von Graz lebt. „Beim gemeinsamen Urlaub in Kroatien haben uns die Kinder gefragt, woher in unserer einsamen Bucht der ganze Plastikmüll kommt und wer daran Schuld ist“, erzählt die Autorin, die sich dann selbst die Frage gestellt hat, welchen Anteil sie und ihre Famile daran trägt. Seit Jahren trenne sie umweltbewusst den Müll. „Das Schlagwort ‚Recycling‘ reichte über Jahre vollkommen aus, um mir und vermutlich dem Großteil der Verbraucher bezüglich des Umgangs mit Müll ein wirklich gutes Gewissen zu bescheren“, schreibt sie in ihrem Buch.
Das Ganze folge jedoch bloß dem Grundsatz „aus den Augen, aus dem Sinn“. Der Film „Plastic Planet“ habe das Fass jedoch endgültig zum Überlaufen gebracht. „Am Anfang stand der sportliche Ehrgeiz, den Haushalt von sämtlichen Plastikprodukten frei zu bekommen und passende Alternativen dazu zu finden“, schildert Krautwaschl. Das geschah im November 2009. „Freunde haben mitgeholfen, Alternativen zu finden und uns mit verschraubbaren Glasgefäßen ausgeholfen, die sie selbst nicht mehr benötigten.“ Damit habe der Umstieg auch eine soziale Komponente bekommen.
Eine weitere Prämisse war auch, dass das neue plastikfrie Leben nicht teurer sein durfte als bisher. Immer deutlicher habe sich dabei herausgestellt, dass es sich vor allem um eine Müllvermeidungsstrategie handelt. „Die Tatsache, dass wir unseren Plastikmüll seit Beginn des Experiments um 95 bis 98 Prozent und den restlichen Müll um rund 50 Prozent reduzieren konnten, reicht mir als persönliche Bestätigung der Sinnhaftigkeit.“